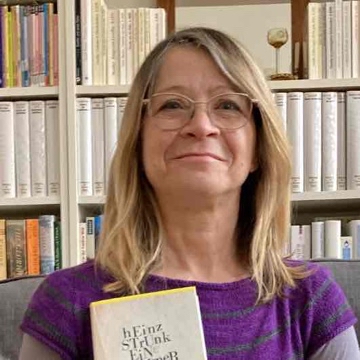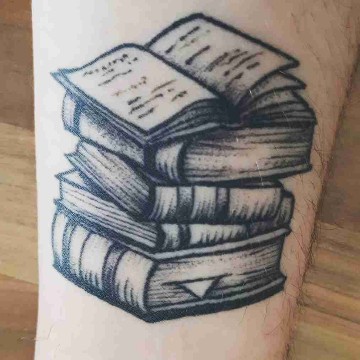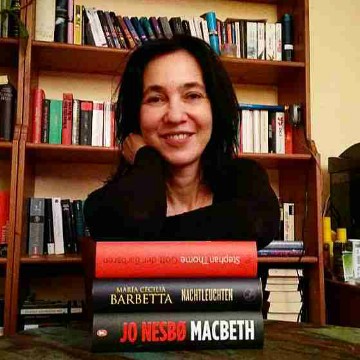Wir verstehen nicht, was geschieht
Jetzt kaufen
Durch das Verwenden dieser Links unterstützt du READO. Wir erhalten eine Vermittlungsprovision, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen.
Beschreibung
Autorenbeschreibung
IKTOR FUNK, geboren 1978 in der Sowjetunion (Kasachstan), kam als Elfjähriger 1990 nach Deutschland. Er ging in Wolfsburg zur Schule, studierte später in Hannover Geschichte, Politik und Soziologie. Seine Magisterarbeit in Geschichte beschäftigte sich mit dem Vergleich mündlicher und schriftlicher Erinnerungen von Gulag-Überlebenden. Viktor Funk arbeitet als Politikredakteur mit dem Schwerpunkt Russland bei der Frankfurter Rundschau. Sein erster Roman »Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich« erschien 2017. Er lebt in Frankfurt am Main.
Beiträge
So gut und wichtig
WER ZEUGT FÜR DIE ZEUGEN? Art Spiegelmans Comic „Maus“, die Serienadaption des Bestsellers von Heather Morris „Tattooist of Auchwitz“, Katharina Baders essayistisches Memoir „Jureks Erben“, Monika Helds Roman „Der Schrecken verliert sich vor Ort“ oder „Die Postkarte“ von Anne Berest sind nur einige bekannte oder gegenwärtige Beispiele aus einer ganzen Reihe von literarischen Auseinandersetzungen mit der Gewaltgeschichte Europas in der Mitte des 20. Jahrhunderts, die das Beziehungsgeflecht zwischen der Generation der Nachgeborenen und jenen der Zeitzeugen in den Mittelpunkt stellen. Auch der Debutroman „Wir verstehen nicht, was geschieht“ des Historikers und Journalisten Viktor Funk ließe sich in diese Aufzählung einreihen, obschon Funks schmaler aber unbedingt zu lesender Text in einigen Punkten vom Muster oben genannter abweicht. So erzählt „Wir verstehen nicht, was geschieht“ die Geschichte des jungen, deutschen Historikers Alexander List, der im Rahmen eines Forschungsvorhabens nach Moskau reist, um einen älteren Witwer namens Lew Mischenko zu interviewen. Lew hat als sowjetischer Kriegsgefangener der Deutschen nicht nur ein Nazi-Lager überlebt, sondern wurde bei der Rückkehr in die Sowjetunion des Verrats und der Kollaboration mit Nazideutschland angeklagt und zu neun Jahren GULAG, dem sowjetischen Zwangsarbeitslagersystem, verurteilt und musste bis zum Tod Stalins 1953 auf seine Freilassung und auf die Rückkehr zu seiner Ehefrau Swetlana warten. List möchte mit diesem Interview und weiteren, die er bereits mit anderen GULAG-Überlebenden führte, eine Antwort darauf finden, wie es Menschen möglich war, zu überleben, auch wenn ihm durch ein Gewaltregime jeglicher Lebenssinn und alle Hoffnung genommen oder vorenthalten wurde. Zur Bedingung für das Teilen seiner und Swetlanas Lebensgeschichte macht Lew die Erfüllung der Bitte, dass Alexander ihn nach Petschora, zu dem Ort, an dem Lew inhaftiert war, zu begleiten und dort einen alten Freund zu treffen und so begeben die beiden sich auf eine mehrtägige Bahnreise, bei der der alte Mann und später auch sein Freund Israelitsch den jungen Deutschen an ihren Erinnerungen teilhaben lassen. Teils chronologisch, häufig fragmentarisch und multimodal in Form von mündlichen Erzählungen, privaten Quellen und wissenschaftlichen Fakten erhält Alexander so nach und nach mehr Puzzleteile des Lebens von Lew und Swetlana, die er doch nicht im Sinne einer abschließenden Antwort seiner Ausgangsfrage zusammensetzen kann, denn er hat natürlich keine Kontrollgruppe für seine Interviewpartner*innen, denn jene, die nicht überlebt haben, können nicht davon berichten, wieso es so kam und darauf weist Lew ihn auch hin. Die, in dieser Aussage des liebenswerten Mannes implizit angelegte Thematisierung von survivors guilt ist nur eines vieler Themen, die Funk in seinem Roman leichtfertig und wie nebenbei einarbeitet. Der Plot des Romans ist nicht besonders dicht, will meinen: hier passiert nicht viel; und doch wird von vielem erzählt, denn der Text handelt von Zeugenschaft, vom Schweigen und Erzählen, von der (Un-)Möglichkeit des Überlebens, vom Wert zwischenmenschlicher Nähe. Im Gegensatz zu den oben genannten Vertreter*innen, wählt Funk jedoch einen anderen Ansatz, denn das Setting des transgenerationalen Erzählen wird genutzt, um zu zeigen, was in der Vergangenheit war als vielmehr, wie es in die Gegenwart hineinragt und so ist der Roman Funks, der auf biografischen Erfahrungen mit GULAG-Überlebenden des Autor beruht, eine Mahnung und Warnung für unsere Gegenwart, in der u.a. eine restriktive russische Geschichtspolitik erneut eine Aufarbeitung des sowjetischen Terrors gegen die eigene Bevölkerung erneut verunmöglicht. Unbedingt lesen! Danke fürs bookfluencen an @lesestress.
Ein Buch, das mich sehr berührt hat, auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle gerne noch ein bisschen mehr erfahren hätte.
Beschreibung
Autorenbeschreibung
IKTOR FUNK, geboren 1978 in der Sowjetunion (Kasachstan), kam als Elfjähriger 1990 nach Deutschland. Er ging in Wolfsburg zur Schule, studierte später in Hannover Geschichte, Politik und Soziologie. Seine Magisterarbeit in Geschichte beschäftigte sich mit dem Vergleich mündlicher und schriftlicher Erinnerungen von Gulag-Überlebenden. Viktor Funk arbeitet als Politikredakteur mit dem Schwerpunkt Russland bei der Frankfurter Rundschau. Sein erster Roman »Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich« erschien 2017. Er lebt in Frankfurt am Main.
Beiträge
So gut und wichtig
WER ZEUGT FÜR DIE ZEUGEN? Art Spiegelmans Comic „Maus“, die Serienadaption des Bestsellers von Heather Morris „Tattooist of Auchwitz“, Katharina Baders essayistisches Memoir „Jureks Erben“, Monika Helds Roman „Der Schrecken verliert sich vor Ort“ oder „Die Postkarte“ von Anne Berest sind nur einige bekannte oder gegenwärtige Beispiele aus einer ganzen Reihe von literarischen Auseinandersetzungen mit der Gewaltgeschichte Europas in der Mitte des 20. Jahrhunderts, die das Beziehungsgeflecht zwischen der Generation der Nachgeborenen und jenen der Zeitzeugen in den Mittelpunkt stellen. Auch der Debutroman „Wir verstehen nicht, was geschieht“ des Historikers und Journalisten Viktor Funk ließe sich in diese Aufzählung einreihen, obschon Funks schmaler aber unbedingt zu lesender Text in einigen Punkten vom Muster oben genannter abweicht. So erzählt „Wir verstehen nicht, was geschieht“ die Geschichte des jungen, deutschen Historikers Alexander List, der im Rahmen eines Forschungsvorhabens nach Moskau reist, um einen älteren Witwer namens Lew Mischenko zu interviewen. Lew hat als sowjetischer Kriegsgefangener der Deutschen nicht nur ein Nazi-Lager überlebt, sondern wurde bei der Rückkehr in die Sowjetunion des Verrats und der Kollaboration mit Nazideutschland angeklagt und zu neun Jahren GULAG, dem sowjetischen Zwangsarbeitslagersystem, verurteilt und musste bis zum Tod Stalins 1953 auf seine Freilassung und auf die Rückkehr zu seiner Ehefrau Swetlana warten. List möchte mit diesem Interview und weiteren, die er bereits mit anderen GULAG-Überlebenden führte, eine Antwort darauf finden, wie es Menschen möglich war, zu überleben, auch wenn ihm durch ein Gewaltregime jeglicher Lebenssinn und alle Hoffnung genommen oder vorenthalten wurde. Zur Bedingung für das Teilen seiner und Swetlanas Lebensgeschichte macht Lew die Erfüllung der Bitte, dass Alexander ihn nach Petschora, zu dem Ort, an dem Lew inhaftiert war, zu begleiten und dort einen alten Freund zu treffen und so begeben die beiden sich auf eine mehrtägige Bahnreise, bei der der alte Mann und später auch sein Freund Israelitsch den jungen Deutschen an ihren Erinnerungen teilhaben lassen. Teils chronologisch, häufig fragmentarisch und multimodal in Form von mündlichen Erzählungen, privaten Quellen und wissenschaftlichen Fakten erhält Alexander so nach und nach mehr Puzzleteile des Lebens von Lew und Swetlana, die er doch nicht im Sinne einer abschließenden Antwort seiner Ausgangsfrage zusammensetzen kann, denn er hat natürlich keine Kontrollgruppe für seine Interviewpartner*innen, denn jene, die nicht überlebt haben, können nicht davon berichten, wieso es so kam und darauf weist Lew ihn auch hin. Die, in dieser Aussage des liebenswerten Mannes implizit angelegte Thematisierung von survivors guilt ist nur eines vieler Themen, die Funk in seinem Roman leichtfertig und wie nebenbei einarbeitet. Der Plot des Romans ist nicht besonders dicht, will meinen: hier passiert nicht viel; und doch wird von vielem erzählt, denn der Text handelt von Zeugenschaft, vom Schweigen und Erzählen, von der (Un-)Möglichkeit des Überlebens, vom Wert zwischenmenschlicher Nähe. Im Gegensatz zu den oben genannten Vertreter*innen, wählt Funk jedoch einen anderen Ansatz, denn das Setting des transgenerationalen Erzählen wird genutzt, um zu zeigen, was in der Vergangenheit war als vielmehr, wie es in die Gegenwart hineinragt und so ist der Roman Funks, der auf biografischen Erfahrungen mit GULAG-Überlebenden des Autor beruht, eine Mahnung und Warnung für unsere Gegenwart, in der u.a. eine restriktive russische Geschichtspolitik erneut eine Aufarbeitung des sowjetischen Terrors gegen die eigene Bevölkerung erneut verunmöglicht. Unbedingt lesen! Danke fürs bookfluencen an @lesestress.