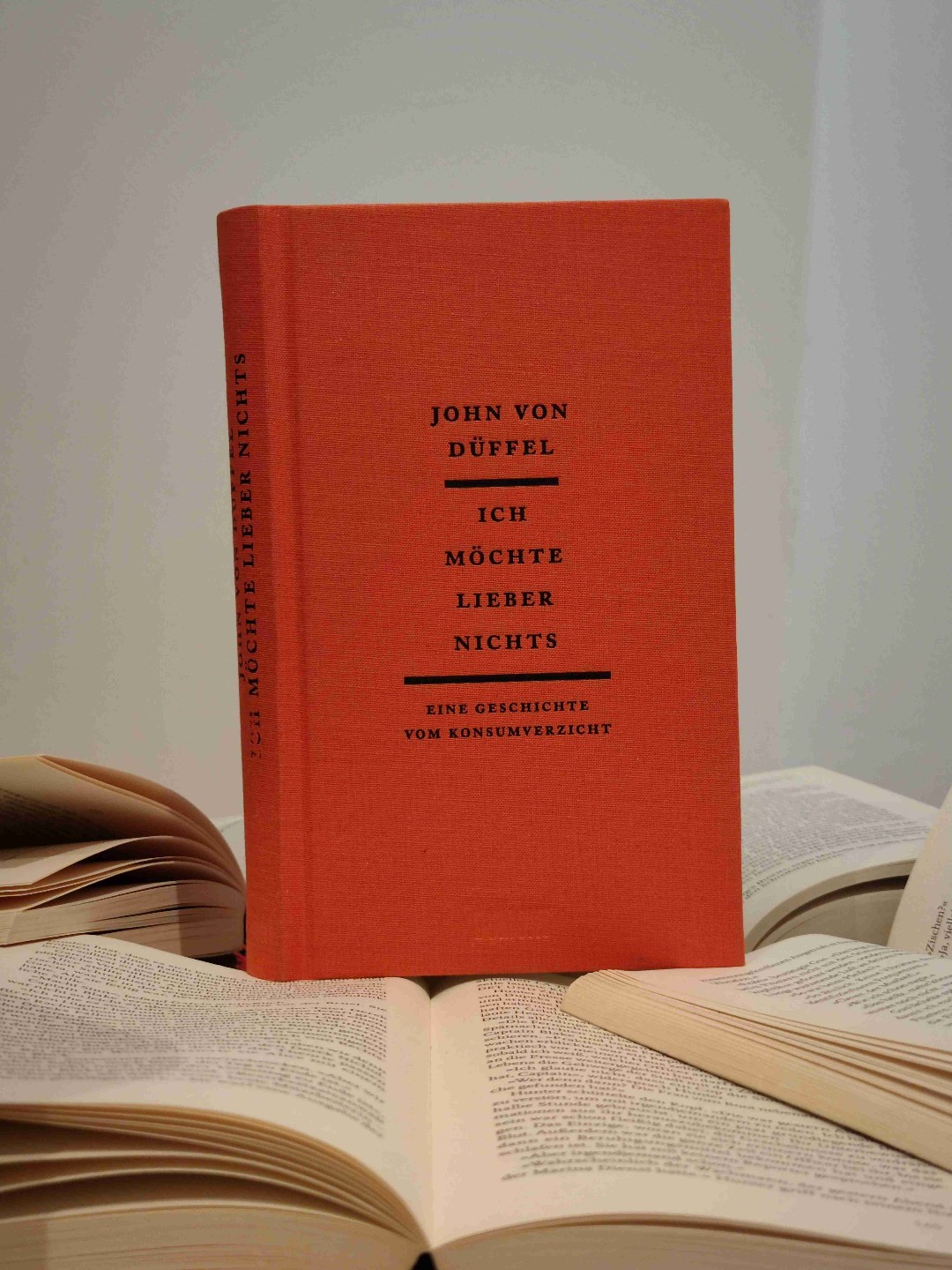Ich möchte lieber nichts
Jetzt kaufen
Durch das Verwenden dieser Links unterstützt du READO. Wir erhalten eine Vermittlungsprovision, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen.
Beschreibung
Autorenbeschreibung
JOHN VON DÜFFEL wurde 1966 in Göttingen geboren, er arbeitete als Dramaturg u. a. am Thalia Theater Hamburg sowie am Deutschen Theater Berlin und ist Professor für Szenisches Schreiben an der Berliner Universität der Künste. Seit 1998 veröffentlicht er Romane, Erzählungsbände sowie essayistische Texte bei DuMont, u. a. ›Vom Wasser‹ (1998), ›Houwelandt‹ (2004), ›Wassererzählungen‹ (2014), ›Klassenbuch‹ (2017), ›Der brennende See‹ (2020), ›Wasser und andere Welten‹ (Neuausgabe 2021), ›Die Wütende
Beiträge
Ich möchte lieber nichts
von John Düffel
Woher soll ich wissen, worauf ich mich einlasse, wenn ich mich nicht darauf einlasse?
Das Buch handelt weniger um Konsum (dauert 50 Seiten, um überhaupt auf dieses Thema zu kommen), eher um Einsamkeit und den eigenen Platz in der Gesellschaft als Individuum, die Infragestellung des Individualismus und letztendlich des Konzepts 'Individuum' selbst, zwischen Freiheit und Gefangensein, zwischen Abhängigkeit und Wunsch nach Wunschlosigkeit, zwischen Isolation und Gemeinschaft, was sich alles bedingt, da ohne gegensätzliche Extremen die Existenz des jeweiligen Konstrukts brüchig und letztlich unmöglich wird. Wenn man sich auf diese dialogische Reise zwischen Fiona und John sowie zwischen John und seinen Gedanken einlässt und nicht eine reine Diskussion über Konsum erwartet, dann empfinde ich das Buch als solide, sonst eher persönlich intim und abstrakt aus überwiegend pessimistischen Perspektiven der Wahrnehmung von Leben und Existenz. Was mir von den Buch bleibt, sind die Gedanken über das Gefangensein in Mustern, die einem Sicherheit geben, aber nicht zufriedenstellen, jedoch bleibt die Angst vor der Veränderung größer, weshalb man selbst die lichten flüchtigen Momente, in denen das Sein und Tun angezweifelt wird und es einen quält, verfliegen lässt, um sich nicht dem Ungewissen des Neuen zu stellen. Zitat: Die Angst vor Veränderung ist größer als die Absurdität des "weiter so". Ich bleibe dennoch mit dem Gedanken zurück, dass von Düffel den Kern, der Verzicht auf Anpassung als impraktikablen Ausbruch aus dem Konsum gekoppelt an die narzisstische Veranlagung eines jeden Menschen, nicht umfassend begriffen habe und eisern an dem Individuum und dessen Fähigkeit, zu denken und zu reflektieren, verharrt, dessen vermeintlich hoffnungsschimmernden Ausblick auf die Unmöglichkeit des Konsumverzichts die Fähigkeit des Menschen zum Gedanken über die Möglichkeit darüber darstellt (die Möglichkeit, Gedanken zu denken). Für mich keine zufriedenstellende 'Erleuchtung', eher ein unbefriedigender Versuch des Trosts. Wenn es dann um den Kern des Konsums (ab Seite 130) geht, verfehlt die Auslegung dessen als narzisstischen Stillsubejekt für mich die große Frage, wie das Individuum, das wie wir bereits bewusster und nachhaltiger konsumiert, ohne Züchtigung seiner selbst ideal konsumiert. Ich behaupte scharf, dass sich viele aus meiner sozialen Bubble der Konsumthematik bewusst sind, hier geht es für mich aber weniger um die Herausstellung sozialer Ungleichheiten, die dann bewusst werden, wenn wir anfangen zu vergleichen, wer was im Restaurant bestellt, sich im Alltag leisten kann oder wer wohin in den Urlaub fliegt, sondern viel mehr um die bewusste Entscheidung der Aneignung, den Besitz von Ressourcen und um den Ausdruck des Ichs (auch wenn wir unbewusst damit unseren Narzissmus beweihräuchern und entschuldigen). Ich stelle aber weniger den Narzissmus des Individuums als Übeltäter an den Pranger, viel mehr den Kapitalismus, der hier dieses Spannungsfeld schafft, sich optimieren zu müssen, da weder Langlebigkeit des Kaufobjekts noch Aktualität, sprich Preis vs. Wert in Abhängigkeit zur Nachfrage und konsenziellem Ansehen, an Konsistenz bewahren. Auch den Abriss nach Maß und Ermessen, um den Konsumnarzismuss zu nihilieren, empfinde ich mehr als Schlupfloch, da die Frage unbeantwortet bleibt: wer gibt das korrekte Maß vor? Falls es das Individuum selbst ist, wirft das die größte Frage nach Ehrlichkeit und Einsicht auf, die niemand beantworten kann. Auch hier wage ich zu behaupten, niemand ist immer und in vollem Ausmaß ehrlich zu sich und anderen. Das Festhalten an dieser Vorstellung empfinde ich töricht und illusioniert. Hingegen finde ich den Anriss, den Fiona zum Konsum skizziert, sehr treffen und in der minimalen Brutalität realistisch, hätte mir jedoch die Tiefe und Weite, die es erst ab Seite 150 annimmt, gerne früher und länger erhofft. Wie das Buch endet, lass ich offen!
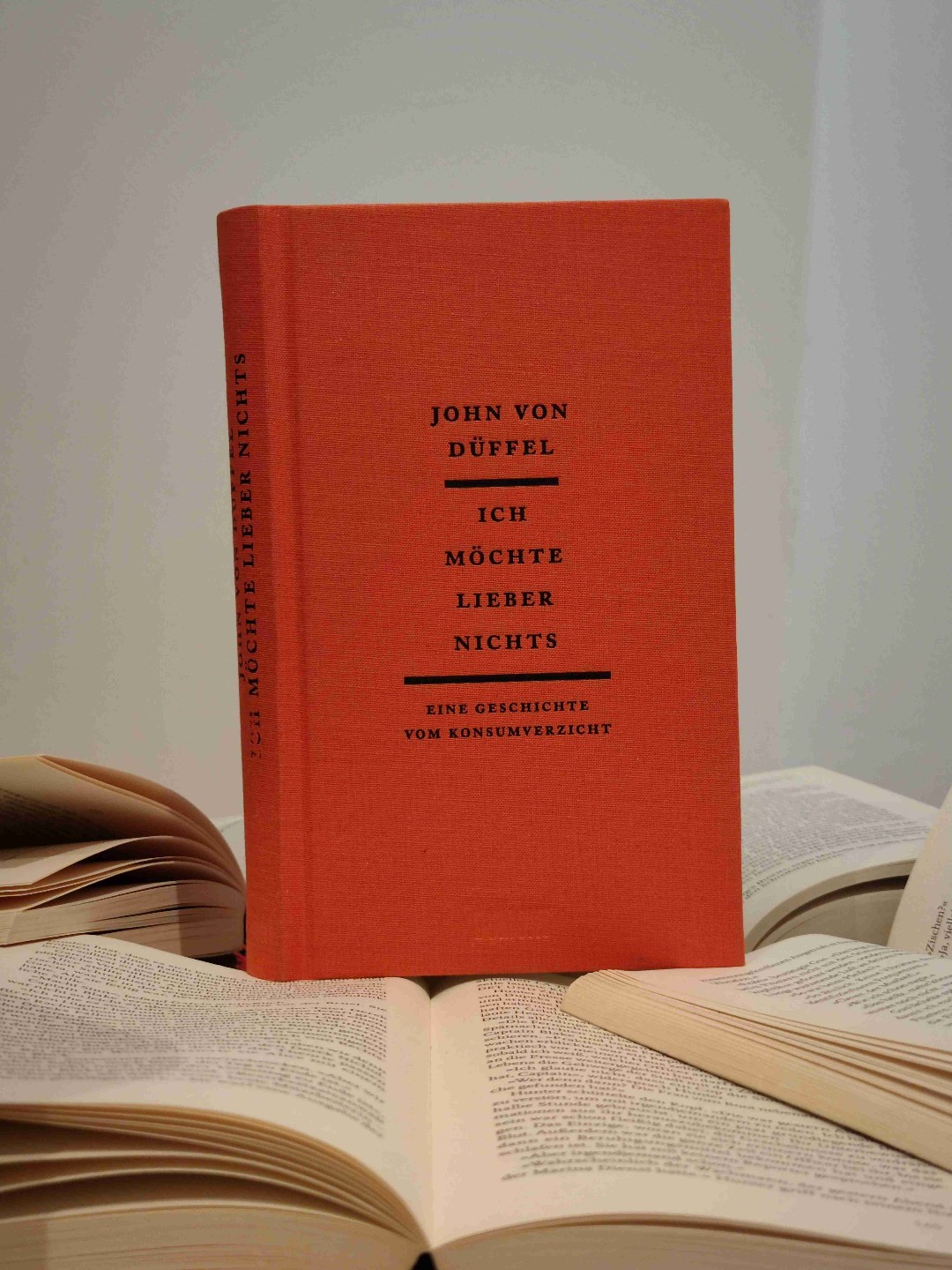
Mehr von John Düffel
AlleBeschreibung
Autorenbeschreibung
JOHN VON DÜFFEL wurde 1966 in Göttingen geboren, er arbeitete als Dramaturg u. a. am Thalia Theater Hamburg sowie am Deutschen Theater Berlin und ist Professor für Szenisches Schreiben an der Berliner Universität der Künste. Seit 1998 veröffentlicht er Romane, Erzählungsbände sowie essayistische Texte bei DuMont, u. a. ›Vom Wasser‹ (1998), ›Houwelandt‹ (2004), ›Wassererzählungen‹ (2014), ›Klassenbuch‹ (2017), ›Der brennende See‹ (2020), ›Wasser und andere Welten‹ (Neuausgabe 2021), ›Die Wütende
Beiträge
Ich möchte lieber nichts
von John Düffel
Woher soll ich wissen, worauf ich mich einlasse, wenn ich mich nicht darauf einlasse?
Das Buch handelt weniger um Konsum (dauert 50 Seiten, um überhaupt auf dieses Thema zu kommen), eher um Einsamkeit und den eigenen Platz in der Gesellschaft als Individuum, die Infragestellung des Individualismus und letztendlich des Konzepts 'Individuum' selbst, zwischen Freiheit und Gefangensein, zwischen Abhängigkeit und Wunsch nach Wunschlosigkeit, zwischen Isolation und Gemeinschaft, was sich alles bedingt, da ohne gegensätzliche Extremen die Existenz des jeweiligen Konstrukts brüchig und letztlich unmöglich wird. Wenn man sich auf diese dialogische Reise zwischen Fiona und John sowie zwischen John und seinen Gedanken einlässt und nicht eine reine Diskussion über Konsum erwartet, dann empfinde ich das Buch als solide, sonst eher persönlich intim und abstrakt aus überwiegend pessimistischen Perspektiven der Wahrnehmung von Leben und Existenz. Was mir von den Buch bleibt, sind die Gedanken über das Gefangensein in Mustern, die einem Sicherheit geben, aber nicht zufriedenstellen, jedoch bleibt die Angst vor der Veränderung größer, weshalb man selbst die lichten flüchtigen Momente, in denen das Sein und Tun angezweifelt wird und es einen quält, verfliegen lässt, um sich nicht dem Ungewissen des Neuen zu stellen. Zitat: Die Angst vor Veränderung ist größer als die Absurdität des "weiter so". Ich bleibe dennoch mit dem Gedanken zurück, dass von Düffel den Kern, der Verzicht auf Anpassung als impraktikablen Ausbruch aus dem Konsum gekoppelt an die narzisstische Veranlagung eines jeden Menschen, nicht umfassend begriffen habe und eisern an dem Individuum und dessen Fähigkeit, zu denken und zu reflektieren, verharrt, dessen vermeintlich hoffnungsschimmernden Ausblick auf die Unmöglichkeit des Konsumverzichts die Fähigkeit des Menschen zum Gedanken über die Möglichkeit darüber darstellt (die Möglichkeit, Gedanken zu denken). Für mich keine zufriedenstellende 'Erleuchtung', eher ein unbefriedigender Versuch des Trosts. Wenn es dann um den Kern des Konsums (ab Seite 130) geht, verfehlt die Auslegung dessen als narzisstischen Stillsubejekt für mich die große Frage, wie das Individuum, das wie wir bereits bewusster und nachhaltiger konsumiert, ohne Züchtigung seiner selbst ideal konsumiert. Ich behaupte scharf, dass sich viele aus meiner sozialen Bubble der Konsumthematik bewusst sind, hier geht es für mich aber weniger um die Herausstellung sozialer Ungleichheiten, die dann bewusst werden, wenn wir anfangen zu vergleichen, wer was im Restaurant bestellt, sich im Alltag leisten kann oder wer wohin in den Urlaub fliegt, sondern viel mehr um die bewusste Entscheidung der Aneignung, den Besitz von Ressourcen und um den Ausdruck des Ichs (auch wenn wir unbewusst damit unseren Narzissmus beweihräuchern und entschuldigen). Ich stelle aber weniger den Narzissmus des Individuums als Übeltäter an den Pranger, viel mehr den Kapitalismus, der hier dieses Spannungsfeld schafft, sich optimieren zu müssen, da weder Langlebigkeit des Kaufobjekts noch Aktualität, sprich Preis vs. Wert in Abhängigkeit zur Nachfrage und konsenziellem Ansehen, an Konsistenz bewahren. Auch den Abriss nach Maß und Ermessen, um den Konsumnarzismuss zu nihilieren, empfinde ich mehr als Schlupfloch, da die Frage unbeantwortet bleibt: wer gibt das korrekte Maß vor? Falls es das Individuum selbst ist, wirft das die größte Frage nach Ehrlichkeit und Einsicht auf, die niemand beantworten kann. Auch hier wage ich zu behaupten, niemand ist immer und in vollem Ausmaß ehrlich zu sich und anderen. Das Festhalten an dieser Vorstellung empfinde ich töricht und illusioniert. Hingegen finde ich den Anriss, den Fiona zum Konsum skizziert, sehr treffen und in der minimalen Brutalität realistisch, hätte mir jedoch die Tiefe und Weite, die es erst ab Seite 150 annimmt, gerne früher und länger erhofft. Wie das Buch endet, lass ich offen!