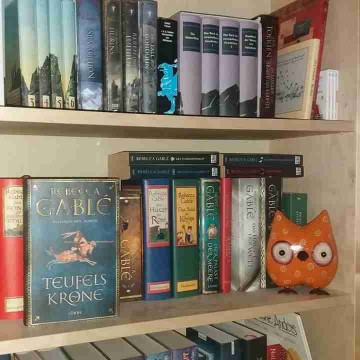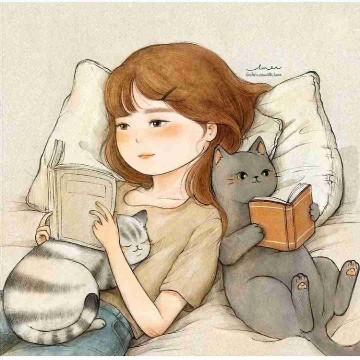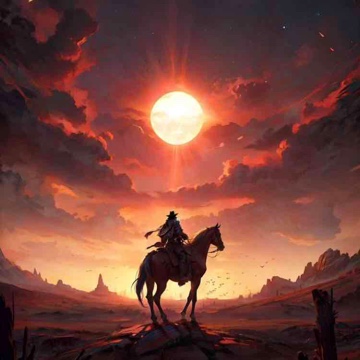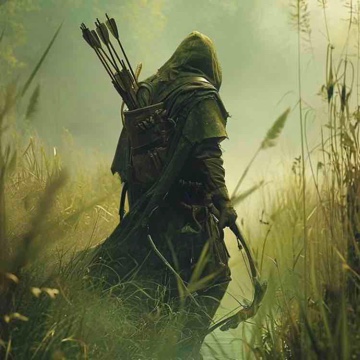Nemesis
Jetzt kaufen
Durch das Verwenden dieser Links unterstützt du READO. Wir erhalten eine Vermittlungsprovision, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen.
Beschreibung
Beiträge
DER FATALISMUS EINER KRANKHEIT UND SCHULD Das sind die großen Themen, mit denen Philip Roth 220 Seiten füllt. In seinem Roman "Nemesis" begegnen wir einem jüdischen Viertel in den USA, in dem die Polio/Kinderlähmung epidemische Ausmaße annimmt. Wir begleiten während den Wirren des Zweiten Weltkrieges einen jungen Sportlehrer, der versucht zu verstehen, warum der Mensch so machtlos gegenüber einer Krankheit ist. Drückende Hitze und letzte paradiesische Sommertage wechseln einander ab und können nicht verbergen, wie das Leid das Leben eines einzelnen Menschen und letztlich das Tausender zerstört. Zu Beginn wirkt das Buch so leicht und galant erzählt und lässt Hoffnung aufkommen, um sie letztlich zu nehmen. Das Ende hat mich gleichsam deprimiert und auch erleichtert. Sprachlich hätte ich mir gern noch etwas mehr gewünscht - insgesamt aber ein wunderbares Buch.
Ein tiefgehendes, sehr einfühlsames Psychogramm über einen Mann, der mit den besten Absichten unaufhaltsam und unbeirrt auf seinen Untergang zusteuert. Wieder mal eine Geschichte, die mich sehr nachdenklich zurücklässt. "Wenn doch nur..." und "Hätte er bloß...", "Warum konnte er nicht einfach..." waren ständige Begleiter in meinem Kopf während des Lesens in diesem Buch. Am Ende kann aber niemand aus seiner eigenen Haut heraus.
So ein dünnes Buch und so viel geballte Ladung Inhalt. Inhaltlich kann man sicher drüber streiten, diskutieren, nachdenken, seine Aussagen teilen oder eben nicht. Aber das macht die Geschichte spannend und Philip Roth ist ein großartiger Erzähler! Und genau das macht dies für mich zu einem wunderbaren Buch!!!!
Philip Roth hat hier einen etwas deprimierenden, aber realistischen Roman geschrieben. Das Buch handelt vordergründig von einer Polioepidemie in den 1940er Jahren, ca. 10 Jahre vor der Erfindung des ersten Impfstoffs, in einer Stadt in New Jersey. Wir begleiten Bucky Cantor, 23 Jahre und Sportlehrer, der nicht verstehen kann wie eine Krankheit zahllose Kinder tötet oder verkrüppelt. Er gibt sich selbst die Schuld und später Gott. Er konzentriert seinen Hass auf einen Antigott der für alles Leid verantwortlich ist. Seine Suche nach Schuld ist fanatisch, er kann nicht sehen dass Unglück und Tragödien passieren ohne dass jemand dies ausgelöst hat oder schuldig ist. Der Roman ist relativ handlungsarm und kann nicht unbedingt mit Sprachgewalt oder Originalität glänzen. Er stellt die innere Zerrissenheit des Protagonisten zwar gut dar, besonders den Drang Männlichkeit zu beweisen. Der damals (und leider auch heute noch oft genug) vorherrschende Erziehungsstil verbindet Männlichkeit mit Stärke und verbietet Schwäche zu zeigen. Für Mr. Cantor ist es die größte Scham ausgemustert zu werden und nicht in den Krieg ziehen zu können. Gleichzeitig muss er ebenfalls einen Krieg ausfechten, gegen einen unsichtbaren, winzig kleinen Feind, den man nicht bekämpfen kann: Das Poliovirus. Dieser Krieg ist nicht weniger grausam als der von Mensch gegen Mensch. Roth erzählt dies alles ohne Pathos oder Kitsch (was an sich ja schon relativ selten und schwierig ist), fast schon sachlich. Trotzdem hat mir etwas an Roths Schreibstil gefehlt, weshalb ich am Ende doch relativ unberührt zurückgeblieben bin.
Sehr bedrückende Geschichte, die sich aber rasch weglesen lässt und einen vor allem zum Ende hin sehr berührt. Wie glücklich können wir sein, dass in unserer Zeit Mittel und Wissen zur Verfügung stehen um auf eine Epidemie so rasch reagieren zu können, wie das in Sachen Corona möglich war. Und dennoch zweifeln viele..... Aber das ist ein anderes Thema, die Parallelen lassen sich aber nicht ignorieren und machen das Buch noch emotionaler.
Das war ziemlich enttäuschend. Bislang hatte ich noch nichts von Philip Roth gelesen, und daher war ich auf die oft gepriesene Erzählkunst des Dauergeheimtipps für den Nobelpreis gespannt. Ich konnte hier aber weder stilistisch, konzeptionell oder sprachlich etwas Besonderes erkennen. Die Geschichte der Polio-Epidemie im Jahr 1944 an der Ostküste der USA wird aus Sicht des 23-jährigen Sportlehrers Bucky Cantor erzählt, der in der ersten Hälfte des Buchs für die Betreuung der Gemeindesportplätze in den Sommerferien und im dritten Viertel für Summercamp-Betreuung in den Wäldern verantwortlich ist. Roth schreibt über ihn: Bucky war weder hochintelligent […] noch im Entferntesten unbekümmert. Er war ein weitgehend humorloser Mann, der sich zwar ausdrücken konnte, aber nicht geistreich war, der nie etwas Satirisches oder Ironisches sagte und kaum je einen Witz machte oder im Scherz sprach.” Dieser letzte Satz beschreibt nicht nur Bucky, sondern auch mein Eindruck vom Buch generell. Es ist in klassischer amerikanischer Art erzählt, auf einer Erzählebene, nett ausgedrückt, aber wenig reflektiert oder geistreich, chronologisch wie ein Katastrophenschutzbericht. Außerdem störte mich die Vielzahl an Wiederholungen und unnötigen Informationen zum Beschreiben eines Sachverhalts, wie in dem oben stehenden Satz (Satire, Ironie, Witz, Scherz! Alla hopp, ich hab’s kapiert, der Typ war ne Spaßbremse). Der erste Geschlechtsakt mit seiner Freundin geschah dann vor Jahren im Spätsommer “an einem Samstag um kurz vor Vier in dem Bett, mit den vier gedrechselten Pfosten und dem Baldachin mit Blumenmuster”. Das hört sich für mich mehr wie eine Bildbeschreibung aus einem IKEA-Katalog an. Inhaltlich habe ich nicht verstanden, was Roth mit dieser Geschichte eigentlich sagen wollte. Bucky ist ein Anti-Hiob. Buckys Vorstellung von Gott war nicht die “von einem allmächtigen Wesen, das keine Dreifaltigkeit war im Christentum, sondern eine Zweifaltigkeit - die Vereinigung eines perversen Arschlochs mit einem bösartigen Genie”. Wirklich kein sehr geistreiche Ausdrucksweise. Reihenweise fallen die Kinder in diesem Sommer dem Poliovirus zum Opfer und der Pratogonist setzt am Ende alles dran, die Tragödie in seine Schuld umzuwandeln. Ein von mir geschätzter Kritiker lobte das Buch als tröstend. Ich habe selten so etwas trostloses gelesen, wenn es um die Frage geht, wie man als Mensch dem übermächtigen Elend in der Welt gegenüberstehen soll. Mir hat das Buch nicht gefallen.
Das war ziemlich enttäuschend. Bislang hatte ich noch nichts von Philip Roth gelesen, und daher war ich auf die oft gepriesene Erzählkunst des Dauergeheimtipps für den Nobelpreis gespannt. Ich konnte hier aber weder stilistisch, konzeptionell oder sprachlich etwas Besonderes erkennen. Die Geschichte der Polio-Epidemie im Jahr 1944 an der Ostküste der USA wird aus Sicht des 23-jährigen Sportlehrers Bucky Cantor erzählt, der in der ersten Hälfte des Buchs für die Betreuung der Gemeindesportplätze in den Sommerferien und im dritten Viertel für Summercamp-Betreuung in den Wäldern verantwortlich ist. Roth schreibt über ihn: Bucky war weder hochintelligent […] noch im Entferntesten unbekümmert. Er war ein weitgehend humorloser Mann, der sich zwar ausdrücken konnte, aber nicht geistreich war, der nie etwas Satirisches oder Ironisches sagte und kaum je einen Witz machte oder im Scherz sprach.” Dieser letzte Satz beschreibt nicht nur Bucky, sondern auch mein Eindruck vom Buch generell. Es ist in klassischer amerikanischer Art erzählt, auf einer Erzählebene, nett ausgedrückt, aber wenig reflektiert oder geistreich, chronologisch wie ein Katastrophenschutzbericht. Außerdem störte mich die Vielzahl an Wiederholungen und unnötigen Informationen zum Beschreiben eines Sachverhalts, wie in dem oben stehenden Satz (Satire, Ironie, Witz, Scherz! Alla hopp, ich hab’s kapiert, der Typ war ne Spaßbremse). Der erste Geschlechtsakt mit seiner Freundin geschah dann vor Jahren im Spätsommer “an einem Samstag um kurz vor Vier in dem Bett, mit den vier gedrechselten Pfosten und dem Baldachin mit Blumenmuster”. Das hört sich für mich mehr wie eine Bildbeschreibung aus einem IKEA-Katalog an. Inhaltlich habe ich nicht verstanden, was Roth mit dieser Geschichte eigentlich sagen wollte. Bucky ist ein Anti-Hiob. Buckys Vorstellung von Gott war nicht die “von einem allmächtigen Wesen, das keine Dreifaltigkeit war im Christentum, sondern eine Zweifaltigkeit - die Vereinigung eines perversen Arschlochs mit einem bösartigen Genie”. Wirklich kein sehr geistreiche Ausdrucksweise. Reihenweise fallen die Kinder in diesem Sommer dem Poliovirus zum Opfer und der Pratogonist setzt am Ende alles dran, die Tragödie in seine Schuld umzuwandeln. Ein von mir geschätzter Kritiker lobte das Buch als tröstend. Ich habe selten so etwas trostloses gelesen, wenn es um die Frage geht, wie man als Mensch dem übermächtigen Elend in der Welt gegenüberstehen soll. Mir hat das Buch nicht gefallen.
Beschreibung
Beiträge
DER FATALISMUS EINER KRANKHEIT UND SCHULD Das sind die großen Themen, mit denen Philip Roth 220 Seiten füllt. In seinem Roman "Nemesis" begegnen wir einem jüdischen Viertel in den USA, in dem die Polio/Kinderlähmung epidemische Ausmaße annimmt. Wir begleiten während den Wirren des Zweiten Weltkrieges einen jungen Sportlehrer, der versucht zu verstehen, warum der Mensch so machtlos gegenüber einer Krankheit ist. Drückende Hitze und letzte paradiesische Sommertage wechseln einander ab und können nicht verbergen, wie das Leid das Leben eines einzelnen Menschen und letztlich das Tausender zerstört. Zu Beginn wirkt das Buch so leicht und galant erzählt und lässt Hoffnung aufkommen, um sie letztlich zu nehmen. Das Ende hat mich gleichsam deprimiert und auch erleichtert. Sprachlich hätte ich mir gern noch etwas mehr gewünscht - insgesamt aber ein wunderbares Buch.
Ein tiefgehendes, sehr einfühlsames Psychogramm über einen Mann, der mit den besten Absichten unaufhaltsam und unbeirrt auf seinen Untergang zusteuert. Wieder mal eine Geschichte, die mich sehr nachdenklich zurücklässt. "Wenn doch nur..." und "Hätte er bloß...", "Warum konnte er nicht einfach..." waren ständige Begleiter in meinem Kopf während des Lesens in diesem Buch. Am Ende kann aber niemand aus seiner eigenen Haut heraus.
So ein dünnes Buch und so viel geballte Ladung Inhalt. Inhaltlich kann man sicher drüber streiten, diskutieren, nachdenken, seine Aussagen teilen oder eben nicht. Aber das macht die Geschichte spannend und Philip Roth ist ein großartiger Erzähler! Und genau das macht dies für mich zu einem wunderbaren Buch!!!!
Philip Roth hat hier einen etwas deprimierenden, aber realistischen Roman geschrieben. Das Buch handelt vordergründig von einer Polioepidemie in den 1940er Jahren, ca. 10 Jahre vor der Erfindung des ersten Impfstoffs, in einer Stadt in New Jersey. Wir begleiten Bucky Cantor, 23 Jahre und Sportlehrer, der nicht verstehen kann wie eine Krankheit zahllose Kinder tötet oder verkrüppelt. Er gibt sich selbst die Schuld und später Gott. Er konzentriert seinen Hass auf einen Antigott der für alles Leid verantwortlich ist. Seine Suche nach Schuld ist fanatisch, er kann nicht sehen dass Unglück und Tragödien passieren ohne dass jemand dies ausgelöst hat oder schuldig ist. Der Roman ist relativ handlungsarm und kann nicht unbedingt mit Sprachgewalt oder Originalität glänzen. Er stellt die innere Zerrissenheit des Protagonisten zwar gut dar, besonders den Drang Männlichkeit zu beweisen. Der damals (und leider auch heute noch oft genug) vorherrschende Erziehungsstil verbindet Männlichkeit mit Stärke und verbietet Schwäche zu zeigen. Für Mr. Cantor ist es die größte Scham ausgemustert zu werden und nicht in den Krieg ziehen zu können. Gleichzeitig muss er ebenfalls einen Krieg ausfechten, gegen einen unsichtbaren, winzig kleinen Feind, den man nicht bekämpfen kann: Das Poliovirus. Dieser Krieg ist nicht weniger grausam als der von Mensch gegen Mensch. Roth erzählt dies alles ohne Pathos oder Kitsch (was an sich ja schon relativ selten und schwierig ist), fast schon sachlich. Trotzdem hat mir etwas an Roths Schreibstil gefehlt, weshalb ich am Ende doch relativ unberührt zurückgeblieben bin.
Sehr bedrückende Geschichte, die sich aber rasch weglesen lässt und einen vor allem zum Ende hin sehr berührt. Wie glücklich können wir sein, dass in unserer Zeit Mittel und Wissen zur Verfügung stehen um auf eine Epidemie so rasch reagieren zu können, wie das in Sachen Corona möglich war. Und dennoch zweifeln viele..... Aber das ist ein anderes Thema, die Parallelen lassen sich aber nicht ignorieren und machen das Buch noch emotionaler.
Das war ziemlich enttäuschend. Bislang hatte ich noch nichts von Philip Roth gelesen, und daher war ich auf die oft gepriesene Erzählkunst des Dauergeheimtipps für den Nobelpreis gespannt. Ich konnte hier aber weder stilistisch, konzeptionell oder sprachlich etwas Besonderes erkennen. Die Geschichte der Polio-Epidemie im Jahr 1944 an der Ostküste der USA wird aus Sicht des 23-jährigen Sportlehrers Bucky Cantor erzählt, der in der ersten Hälfte des Buchs für die Betreuung der Gemeindesportplätze in den Sommerferien und im dritten Viertel für Summercamp-Betreuung in den Wäldern verantwortlich ist. Roth schreibt über ihn: Bucky war weder hochintelligent […] noch im Entferntesten unbekümmert. Er war ein weitgehend humorloser Mann, der sich zwar ausdrücken konnte, aber nicht geistreich war, der nie etwas Satirisches oder Ironisches sagte und kaum je einen Witz machte oder im Scherz sprach.” Dieser letzte Satz beschreibt nicht nur Bucky, sondern auch mein Eindruck vom Buch generell. Es ist in klassischer amerikanischer Art erzählt, auf einer Erzählebene, nett ausgedrückt, aber wenig reflektiert oder geistreich, chronologisch wie ein Katastrophenschutzbericht. Außerdem störte mich die Vielzahl an Wiederholungen und unnötigen Informationen zum Beschreiben eines Sachverhalts, wie in dem oben stehenden Satz (Satire, Ironie, Witz, Scherz! Alla hopp, ich hab’s kapiert, der Typ war ne Spaßbremse). Der erste Geschlechtsakt mit seiner Freundin geschah dann vor Jahren im Spätsommer “an einem Samstag um kurz vor Vier in dem Bett, mit den vier gedrechselten Pfosten und dem Baldachin mit Blumenmuster”. Das hört sich für mich mehr wie eine Bildbeschreibung aus einem IKEA-Katalog an. Inhaltlich habe ich nicht verstanden, was Roth mit dieser Geschichte eigentlich sagen wollte. Bucky ist ein Anti-Hiob. Buckys Vorstellung von Gott war nicht die “von einem allmächtigen Wesen, das keine Dreifaltigkeit war im Christentum, sondern eine Zweifaltigkeit - die Vereinigung eines perversen Arschlochs mit einem bösartigen Genie”. Wirklich kein sehr geistreiche Ausdrucksweise. Reihenweise fallen die Kinder in diesem Sommer dem Poliovirus zum Opfer und der Pratogonist setzt am Ende alles dran, die Tragödie in seine Schuld umzuwandeln. Ein von mir geschätzter Kritiker lobte das Buch als tröstend. Ich habe selten so etwas trostloses gelesen, wenn es um die Frage geht, wie man als Mensch dem übermächtigen Elend in der Welt gegenüberstehen soll. Mir hat das Buch nicht gefallen.
Das war ziemlich enttäuschend. Bislang hatte ich noch nichts von Philip Roth gelesen, und daher war ich auf die oft gepriesene Erzählkunst des Dauergeheimtipps für den Nobelpreis gespannt. Ich konnte hier aber weder stilistisch, konzeptionell oder sprachlich etwas Besonderes erkennen. Die Geschichte der Polio-Epidemie im Jahr 1944 an der Ostküste der USA wird aus Sicht des 23-jährigen Sportlehrers Bucky Cantor erzählt, der in der ersten Hälfte des Buchs für die Betreuung der Gemeindesportplätze in den Sommerferien und im dritten Viertel für Summercamp-Betreuung in den Wäldern verantwortlich ist. Roth schreibt über ihn: Bucky war weder hochintelligent […] noch im Entferntesten unbekümmert. Er war ein weitgehend humorloser Mann, der sich zwar ausdrücken konnte, aber nicht geistreich war, der nie etwas Satirisches oder Ironisches sagte und kaum je einen Witz machte oder im Scherz sprach.” Dieser letzte Satz beschreibt nicht nur Bucky, sondern auch mein Eindruck vom Buch generell. Es ist in klassischer amerikanischer Art erzählt, auf einer Erzählebene, nett ausgedrückt, aber wenig reflektiert oder geistreich, chronologisch wie ein Katastrophenschutzbericht. Außerdem störte mich die Vielzahl an Wiederholungen und unnötigen Informationen zum Beschreiben eines Sachverhalts, wie in dem oben stehenden Satz (Satire, Ironie, Witz, Scherz! Alla hopp, ich hab’s kapiert, der Typ war ne Spaßbremse). Der erste Geschlechtsakt mit seiner Freundin geschah dann vor Jahren im Spätsommer “an einem Samstag um kurz vor Vier in dem Bett, mit den vier gedrechselten Pfosten und dem Baldachin mit Blumenmuster”. Das hört sich für mich mehr wie eine Bildbeschreibung aus einem IKEA-Katalog an. Inhaltlich habe ich nicht verstanden, was Roth mit dieser Geschichte eigentlich sagen wollte. Bucky ist ein Anti-Hiob. Buckys Vorstellung von Gott war nicht die “von einem allmächtigen Wesen, das keine Dreifaltigkeit war im Christentum, sondern eine Zweifaltigkeit - die Vereinigung eines perversen Arschlochs mit einem bösartigen Genie”. Wirklich kein sehr geistreiche Ausdrucksweise. Reihenweise fallen die Kinder in diesem Sommer dem Poliovirus zum Opfer und der Pratogonist setzt am Ende alles dran, die Tragödie in seine Schuld umzuwandeln. Ein von mir geschätzter Kritiker lobte das Buch als tröstend. Ich habe selten so etwas trostloses gelesen, wenn es um die Frage geht, wie man als Mensch dem übermächtigen Elend in der Welt gegenüberstehen soll. Mir hat das Buch nicht gefallen.