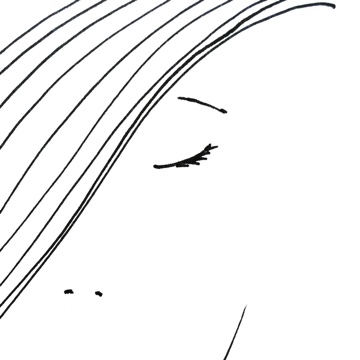Das Gartenzimmer
Jetzt kaufen
Durch das Verwenden dieser Links unterstützt du READO. Wir erhalten eine Vermittlungsprovision, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen.
Beschreibung
Autorenbeschreibung
ANDREAS SCHÄFER wurde 1969 in Hamburg geboren, wuchs bei Frankfurt/Main auf und lebt heute mit seiner Familie in Berlin. Er schreibt Romane, Essays, Libretti und Radiofeatures. Sein Debüt ›Auf dem Weg nach Messara‹ wurde u. a. mit dem Bremer Literaturförderpreis ausgezeichnet. Es folgten die Romane ›Wir vier‹ (DuMont 2010), der für den Deutschen Buchpreis nominiert war und mit dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde, ›Gesichter‹ (DuMont 2013) und zuletzt der Spiegel-Bestseller ›Das Gartenzimm
Beiträge
Elegisches Architekturmärchen Man sagt Häuser haben eine Seele, sie tragen die Erinnerungen und Schicksale der Menschen, die in ihnen gelebt haben, in sich. Kann man in einem Haus mit dunkler Vergangenheit jemals glücklich werden? Diese Frage stellt Andreas Schäfers pointierter Roman "Das Gartenzimmer". Anhand der bewegten Geschichte einer Berliner Villa zeigt er auf, welchen Einfluss die Vergangenheit auf unser Leben hat und auf die Räume, die wir uns dafür einrichten. Die Handlung des Romans spielt auf mehreren Zeitebenen. Von 1908 bis 2013 erstreckt sich die erzählte Zeit. Die “Villa Rosen” ist das erste Projekt des jungen Architekten Max Taubert. Der Erzähler fängt die distanzierte, spröde Persönlichkeit des Architektur-Künstlers wunderbar ein. Elsa Rosen, die erste Bewohnerin des Hauses, ist begeistert von dem jungen Mann, den sie später verstoßen wird. Die charakterstarke Dame prägt das Haus mit ihren Soireen und Künstlerfesten. Später wird Hannah Lekebusch, die zweite Bewohnerin zu Beginn des 21. Jahrhunderts, versuchen, sie zu imitieren. Vergangenheit und Gegenwart spiegeln sich an vielen Stellen dieses so besonderen Romans. Was machen “museale”, unter Denkmalschutz stehende Häuser mit ihren Bewohnern? Die Auflagen des Denkmalamts müssen erfüllt werden, aber noch schlimmer ist der unsichtbare Druck, den die Lekebuschs sich machen, vor allem Hannah. Sie lebt in einem Museum, während ihr Mann Frieder, der mit Placebos reich geworden ist, nur “etwas Echtes” erhalten möchte. Auch vor der nächsten Generation machen die Probleme nicht halt: Der Erbe der Lekebuschs, ihr Sohn Luis, kriminalisiert das Haus. Er sucht eine Zuflucht vor den Gespenstern aus Vergangenheit und Gegenwart. Wird er sie finden? Wie bei einer Renovierung bzw. Restaurierung legt der Erzähler nach und nach eine Schicht der tiefenpsychologischen Beschaffenheit des Hauses und des Ichs aller Personen, die mit ihm zu tun haben, frei. Es ist ein ständiges Distanzieren, Definieren, Möblieren und Renovieren, was hier vor sich geht; das Haus Projektionsfläche von Wünschen, Befürchtungen und Ängsten. Das titelgebende Gartenzimmer ist das Symbol für die unheimliche Seele und verlorene Unschuld des Hauses. Sein düsterer Kern, den Hannah Lekebusch am liebsten verdrängen würde. Überhaupt ist das ganze Untergeschoss ein ihr unangenehmer Ort. Sie ist gleichsam angezogen und abgestoßen von dem monströsen Haus, in das sie viel Energie und Herzblut gesteckt hat. Viel wird in diesem stimmungsvollen Roman nur hauchzart und behutsam angedeutet, er steckt voller Symbolik. Poetisch wunderschön und leise erzählt, mit so vielen Zwischentönen, wie es sonst nur die großen klassischen Erzähler der alten Schule können. Ich denke an Thomas Mann, Eduard von Keyserling, Robert Walser, wenn ich Andreas Schäfer lese. Es gelingt ihm wunderbar, Stimmungen in seiner vielschichtigen Prosa einzufangen und auszudrücken. Er schafft die Atmosphäre, die das Kopfkino des Lesers zum Laufen bringt. Elegisch, traurig, melancholisch - und doch so wunderschön.
Ein sehr deutsches Buch. Das macht seinen Reiz aus, darauf beruht alles, es stellt aber auch seine Schwäche dar. Für mich wurde hier zuviel zusammengedrängt und zu wenig entfaltet. Am Ende bleiben zu viele Fragen offen, wichtige und weniger wichtige, gewiß, aber so bleibt ein Eindruck des Auseinanderfransens, des Zerlaufens. Das Buch erzählt die Geschichte eines Architektenhauses in Berlin-Dahlem und der Menschen, die mit ihm in über hundert Jahren verbunden sind. Es ist ein privilegiertes Leben, das nur selten mit der Außenwelt in Berührung zu kommen oder in Unordnung zu geraten scheint. Im Fokus von Empfindungen und Geschehnissen steht dabei das titelgebende Gartenzimmer.
Titel, Optik und Thema des Buches sprachen mich persönlich direkt auf den ersten Blick an. Die Geschichte nahm nicht den Verlauf, mit dem ich gerechnet hatte.
Die Wechsel zwischen den Zeitenebenen waren für mich nicht immer ganz leicht nachzuvollziehen, insgesamt hat mich die Geschichte des Hauses und seine architektonische Beschreibung dennoch angesprochen.
Beschreibung
Autorenbeschreibung
ANDREAS SCHÄFER wurde 1969 in Hamburg geboren, wuchs bei Frankfurt/Main auf und lebt heute mit seiner Familie in Berlin. Er schreibt Romane, Essays, Libretti und Radiofeatures. Sein Debüt ›Auf dem Weg nach Messara‹ wurde u. a. mit dem Bremer Literaturförderpreis ausgezeichnet. Es folgten die Romane ›Wir vier‹ (DuMont 2010), der für den Deutschen Buchpreis nominiert war und mit dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde, ›Gesichter‹ (DuMont 2013) und zuletzt der Spiegel-Bestseller ›Das Gartenzimm
Beiträge
Elegisches Architekturmärchen Man sagt Häuser haben eine Seele, sie tragen die Erinnerungen und Schicksale der Menschen, die in ihnen gelebt haben, in sich. Kann man in einem Haus mit dunkler Vergangenheit jemals glücklich werden? Diese Frage stellt Andreas Schäfers pointierter Roman "Das Gartenzimmer". Anhand der bewegten Geschichte einer Berliner Villa zeigt er auf, welchen Einfluss die Vergangenheit auf unser Leben hat und auf die Räume, die wir uns dafür einrichten. Die Handlung des Romans spielt auf mehreren Zeitebenen. Von 1908 bis 2013 erstreckt sich die erzählte Zeit. Die “Villa Rosen” ist das erste Projekt des jungen Architekten Max Taubert. Der Erzähler fängt die distanzierte, spröde Persönlichkeit des Architektur-Künstlers wunderbar ein. Elsa Rosen, die erste Bewohnerin des Hauses, ist begeistert von dem jungen Mann, den sie später verstoßen wird. Die charakterstarke Dame prägt das Haus mit ihren Soireen und Künstlerfesten. Später wird Hannah Lekebusch, die zweite Bewohnerin zu Beginn des 21. Jahrhunderts, versuchen, sie zu imitieren. Vergangenheit und Gegenwart spiegeln sich an vielen Stellen dieses so besonderen Romans. Was machen “museale”, unter Denkmalschutz stehende Häuser mit ihren Bewohnern? Die Auflagen des Denkmalamts müssen erfüllt werden, aber noch schlimmer ist der unsichtbare Druck, den die Lekebuschs sich machen, vor allem Hannah. Sie lebt in einem Museum, während ihr Mann Frieder, der mit Placebos reich geworden ist, nur “etwas Echtes” erhalten möchte. Auch vor der nächsten Generation machen die Probleme nicht halt: Der Erbe der Lekebuschs, ihr Sohn Luis, kriminalisiert das Haus. Er sucht eine Zuflucht vor den Gespenstern aus Vergangenheit und Gegenwart. Wird er sie finden? Wie bei einer Renovierung bzw. Restaurierung legt der Erzähler nach und nach eine Schicht der tiefenpsychologischen Beschaffenheit des Hauses und des Ichs aller Personen, die mit ihm zu tun haben, frei. Es ist ein ständiges Distanzieren, Definieren, Möblieren und Renovieren, was hier vor sich geht; das Haus Projektionsfläche von Wünschen, Befürchtungen und Ängsten. Das titelgebende Gartenzimmer ist das Symbol für die unheimliche Seele und verlorene Unschuld des Hauses. Sein düsterer Kern, den Hannah Lekebusch am liebsten verdrängen würde. Überhaupt ist das ganze Untergeschoss ein ihr unangenehmer Ort. Sie ist gleichsam angezogen und abgestoßen von dem monströsen Haus, in das sie viel Energie und Herzblut gesteckt hat. Viel wird in diesem stimmungsvollen Roman nur hauchzart und behutsam angedeutet, er steckt voller Symbolik. Poetisch wunderschön und leise erzählt, mit so vielen Zwischentönen, wie es sonst nur die großen klassischen Erzähler der alten Schule können. Ich denke an Thomas Mann, Eduard von Keyserling, Robert Walser, wenn ich Andreas Schäfer lese. Es gelingt ihm wunderbar, Stimmungen in seiner vielschichtigen Prosa einzufangen und auszudrücken. Er schafft die Atmosphäre, die das Kopfkino des Lesers zum Laufen bringt. Elegisch, traurig, melancholisch - und doch so wunderschön.
Ein sehr deutsches Buch. Das macht seinen Reiz aus, darauf beruht alles, es stellt aber auch seine Schwäche dar. Für mich wurde hier zuviel zusammengedrängt und zu wenig entfaltet. Am Ende bleiben zu viele Fragen offen, wichtige und weniger wichtige, gewiß, aber so bleibt ein Eindruck des Auseinanderfransens, des Zerlaufens. Das Buch erzählt die Geschichte eines Architektenhauses in Berlin-Dahlem und der Menschen, die mit ihm in über hundert Jahren verbunden sind. Es ist ein privilegiertes Leben, das nur selten mit der Außenwelt in Berührung zu kommen oder in Unordnung zu geraten scheint. Im Fokus von Empfindungen und Geschehnissen steht dabei das titelgebende Gartenzimmer.
Titel, Optik und Thema des Buches sprachen mich persönlich direkt auf den ersten Blick an. Die Geschichte nahm nicht den Verlauf, mit dem ich gerechnet hatte.
Die Wechsel zwischen den Zeitenebenen waren für mich nicht immer ganz leicht nachzuvollziehen, insgesamt hat mich die Geschichte des Hauses und seine architektonische Beschreibung dennoch angesprochen.